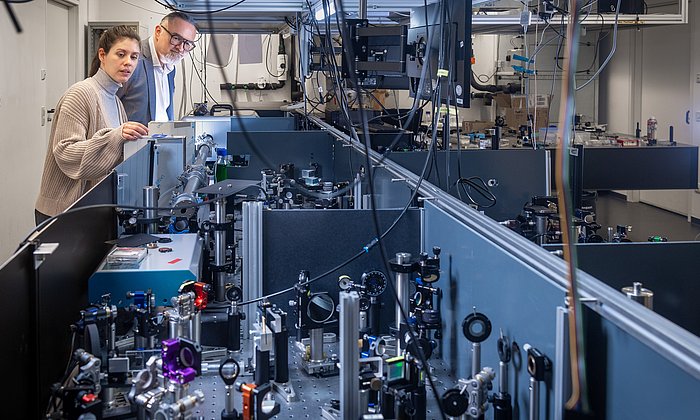E-Learning-Projekt im TUM-Ideenwettbewerb 2025/26
Wie eine Plattform die Mathematik-Ausbildung verändert

Sie entwickeln seit Jahren E-Learning-Materialien für Studierende. Was hat Sie motiviert, sich so intensiv mit digitaler Lehre zu beschäftigen?
Angefangen hat es vor über 10 Jahren damit, dass ich Studierenden eine Brücke zwischen der Vorlesung und für sie schwierigen Übungsaufgaben bauen wollte. Ich entwickelte Verständnisfragen als E-Test in Moodle, damit sie sich tiefer mit dem Stoff beschäftigten. Nachdem sie diese sehr gut annahmen, baute ich die digitale Lehre immer weiter aus. Mich motiviert das Feedback der Studierenden, dass ihnen meine Materialien weiterhelfen.
Worum geht es bei Ihrem neuen Projekt „E-Learning in der Mathematik-Ausbildung“ – und was möchten Sie damit verändern?
Wir bauen eine große Fragendatenbank mit elektronischen Aufgaben auf, die Studierende diverser Fächer in möglichst vielen Lehrveranstaltungen nutzen sollen. Die Entwicklung hochwertiger Aufgaben ist sehr zeitaufwändig. Ich hoffe, die Mathematik-Ausbildung so qualitativ zu verbessern und optimale Lernbedingungen zu schaffen. Denn Mathematik ist in vielen technischen Studiengängen eine unverzichtbare Basis.
Das E-Learning-Tool STACK ist für die neue Plattform zentral. Was kann dieses Tool, das klassische Übungsblätter nicht können?
Mit STACK kann man Aufgaben stellen, die weit über klassische Multiple-Choice-Fragen hinausgehen – beispielsweise interaktive Aufgaben mit Grafiken, die das visuelle Verständnis fördern. Die größten Vorteile sind direktes und automatisiertes Feedback, die Option, es individuell anzupassen und die Randomisierung von Aufgaben.
Die Korrektur klassischer Übungsblätter dauert meist 1-2 Wochen. Bei elektronischen Aufgaben können Studierende direkt nach der Eingabe sehen, ob sie richtig liegen und die Musterlösung lesen. Zudem ist individuelles Feedback möglich. Wenn sie einen Fehler machen, lässt sich ein Text einblenden, der speziell darauf eingeht.
Durch Randomisierung sind die Aufgaben so programmiert, dass die Zahlen oder Parameter zufällig gewählt sind, damit es viele verschiedene Versionen gibt. Bei Schwierigkeiten mit einem Aufgabentyp können sie so gezielt an ihren Schwächen arbeiten. Auch das Lernen im eigenen Tempo ist ein großer Vorteil.
Sie greifen auch auf Aufgabenpools anderer Universitäten wie der ETH Zürich oder der TU Berlin zurück. Wie wichtig ist die Kooperation über Hochschulgrenzen hinweg?
Sehr wichtig. Wir teilen die Fragenpools und helfen uns, Lücken in Aufgabensammlungen zu schließen. Doch unsere Zusammenarbeit beschränkt sich nicht nur darauf: Wir treffen uns regelmäßig und tauschen uns über unsere Erfahrungen in der digitalen Lehre aus. An manchen Aufgaben arbeiten wir gemeinsam – aktuell etwa mit der FAU Erlangen-Nürnberg an der Entwicklung aufwändiger Visualisierungen. Die Kooperation besteht seit dem Frühjahr 2024 und inzwischen sind 9 Universitäten und Hochschulen an diesem Gemeinschaftsprojekt namens SASIM beteiligt.
Blicken wir auf die nächsten fünf bis zehn Jahre: Welche Trends sehen Sie in der digitalen Hochschullehre – und wie verändert digitales Lernen die Rolle von Lehrenden?
Die Nutzung digitaler Lernformen wird weiter zunehmen. Sie ergänzen die klassische Lehre sehr gut. Lehrende können frühzeitig erkennen, wo Studierende Schwierigkeiten haben und in den Präsenzstunden entsprechende Schwerpunkte setzen. Umgekehrt sehen auch Studierende durch digitales Feedback schnell, wo sie Hilfe einholen sollten. So lässt sich die Lehre viel besser auf ihre Bedürfnisse abstimmen.
Ich gehe auch fest davon aus, dass Studierende KI immer mehr nutzen werden. Unsere Aufgabe als Lehrende wird es sein, ein Lehrkonzept zu entwickeln, das Präsenzlehre mit KI und klassischer digitaler Lehre verbindet, um ihnen ein ideales Gesamtpaket zu bieten. Nach einer Umfrage in diesem Sommersemester nutzen schon jetzt über 50% KI als Hilfsmittel, um digitale Übungsaufgaben zu lösen.
Wann haben Sie in der bisherigen Projektarbeit besonders gespürt, dass sich das alles lohnt?
Es ist vor allem das kontinuierlich positive Feedback der Studierenden. Wenn jemand schreibt: „Ohne die E-Tests hätte ich die Mathe-Prüfung im letzten Semester nicht bestanden“ oder eine kurze Nachricht kommt wie „Vielen Dank für die 3D-Visualisierung der Richtungsableitung. Sehr tolle Sache!“, dann merkt man einfach, dass sich die Arbeit lohnt.
Wir haben gerade eine Umfrage unter Studierenden der Mathematik, Physik und diverser technischer Studiengänge über unsere E-Tests durchgeführt. Von 435 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gaben 402 an, dass sie eine wertvolle Ergänzung des Lehrbetriebs sind. Knapp 80% wünschen sich, dass es solche E-Tests auch in anderen Lehrveranstaltungen gibt.
Technische Universität München
- Natalie Neudert
- natalie.neudert@tum.de