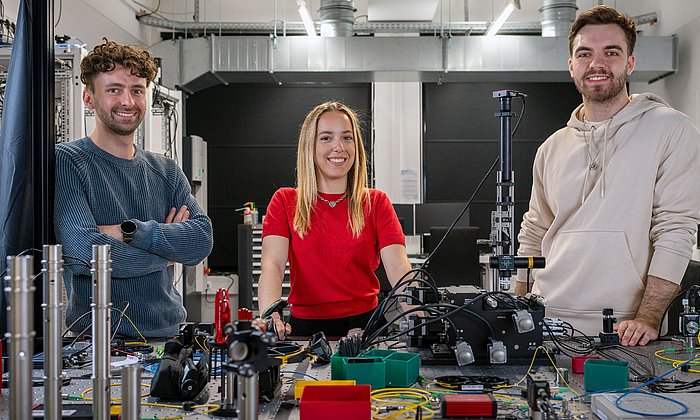Student Club iGEM
Ein Tattoo als Biosensor

Drachen, Herzen, Schmetterlinge – die Zeichnungen, die Kalina Elkin in den Händen hält, könnten auch aus dem Katalog eines Tätowierstudios stammen. Doch es handelt sich um Designentwürfe für ein ganz besonderes Tattoo: „Unser Ziel ist es, die Farbfläche als Biosensor für das Sexualhormon Progesteron zu nutzen. Dieses Prinzip könnte man aber auch auf andere Biomarker übertragen”, sagt Elkin.
Die Idee: Wenn die Progesteron-Konzentration im Körper einen bestimmten Wert überschreitet, soll sich das Biosensor-Tattoo dunkler färben. So ließe sich der Hormonstatus auf einen Blick ablesen, ohne Blutabnahme und Laboruntersuchung. „Ein solches Tattoo könnte dabei helfen, den weiblichen Zyklus zu tracken, zum Beispiel bei Kinderwunsch“, erklärt Elkin. Sie studiert Life Sciences Biologie im Bachelor an der TUM und engagiert sich bei der Studierendeninitiative iGEM Munich.
Mit seinem Konzept „InkSight“ hat das Münchner Team im Oktober 2025 am iGEM-Finale in Paris teilgenommen. Die Studierenden erreichten die Top 10 in der Gesamtwertung und gewannen eine Goldmedaille sowie mehrere Sonderpreise. iGEM steht für „International Genetically Engineered Machine competition“ und ist ein studentischer Wettbewerb auf dem Gebiet der synthetischen Biologie. Ziel ist es, Studierende möglichst früh an das wissenschaftliche Arbeiten heranzuführen.
Was 2004 als Veranstaltung mit fünf Uni-Teams in Boston an der US-amerikanischen Ostküste begann, hat sich zu einem international bekannten Treffen für Forschungsfragen rund um die synthetische Biologie entwickelt. 2025 nahmen mehr als 400 Schul- und Hochschulteams aus aller Welt am dreitägigen Finale im Pariser Convention Center teil. Neben dem eigentlichen Wettbewerb gab es ein Programm mit Fachvorträgen. Auch Start-ups und etablierte Unternehmen konnten sich präsentieren.
Teams in München und Straubing
Das achtköpfige Team war nicht die erste Münchner Beteiligung am iGEM-Wettbewerb: Jedes Jahr im November schließen sich interessierte Studierende der TUM und der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) zusammen. Sie arbeiten zwei Semester lang an ihrem Forschungsprojekt – von der ersten Idee über die Planung und Durchführung der Experimente bis hin zur fertigen Dokumentation. Zu den Anforderungen des Wettbewerbs gehört auch das Organisieren von Fördergeldern, ebenso wie der Austausch mit der Öffentlichkeit. So hat das Team 2025 zum Beispiel einen dreitägigen Bioengineering-Crashkurs für den Biologie-Leistungskurs des Garchinger Gymnasiums organisiert.
Am TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit gab es 2024 ein erstes iGEM-Team. Die Straubinger Studierenden wollen 2026 erneut beim Wettbewerb für synthetische Biologie antreten.
Molekulare Bausteine designen und zusammenfügen
In der synthetischen Biologie, auch „Engineering Biology“ genannt, werden molekulare Bausteine – meist Proteine oder DNA – mithilfe ingenieurwissenschaftlicher Prinzipien so konstruiert, dass sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Diese Komponenten lassen sich zu größeren biologischen Systemen zusammenfügen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse fließen in die Entwicklung neuer Medikamente und Materialien ein.
„Durch den iGEM-Wettbewerb gewinnen die Studierenden wertvolle Einblicke in die Anwendungsgebiete der synthetischen Biologie“, sagt Gil Westmeyer. Er ist Professor für Neurobiological Engineering an der TUM und begleitet die Teams von iGEM Munich seit 2016. „Es ist schön zu sehen, wie engagiert sie versuchen, ihre Ideen im Labor Wirklichkeit werden zu lassen. Mit dem neuen Exzellenzcluster für synthetische Biologie in München, ‚BioSysteM‘, werden sich für viele weitere Studierende spannende Möglichkeiten ergeben.“
Die studentischen Forschungsprojekte von iGEM Munich wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. So konnten die Studierenden beispielsweise 2016 mit einem 3D-Druckverfahren für lebendes Gewebe den Hauptpreis nach München holen. Das übergeordnete Ziel dabei war es, menschliche Organe für die Transplantationsmedizin künstlich herzustellen.
„Lebende Biosensoren“ für verschiedene Biomarker
Das Konzept des Biosensor-Tattoos, mit dem das iGEM-Team 2025 am Wettbewerb teilnahm, basiert auf menschlichen Zellen, die in einem Hydrogel eingebettet sind. Mithilfe gentechnischer Methoden haben die Studierenden diesen Zellen in ihren Experimenten käfigartige Nanostrukturen hinzugefügt, die im Inneren den Hautfarbstoff Melanin produzieren. Wird ein bestimmter Wert des Hormons Progesteron im Körper überschritten, soll dies ein Rezeptor auf der Zellaußenwand registrieren – so die Idee. Daraufhin soll eine Abfolge von Signalen dazu führen, dass sich die Nanokäfige gleichmäßig im Inneren der Zellen verteilen. Das Tattoo erscheint dunkler. „Damit ließe sich auf einen Blick erkennen, ob ein kritischer Bereich erreicht ist“, sagt Kalina Elkin.
Perspektivisch stellen sich die Studierenden ein Tattoo mit verschiedenfarbigen Flächen vor, das Veränderungen mehrerer Biomarker gleichzeitig misst. „Das Prinzip des ‚lebenden Biosensors‘ und unsere Software könnten in Zukunft auf andere Biomarker angewendet werden, die auf bestimmte Gesundheitswerte hindeuten”, sagt Friedrich Irmer, der Bioinformatik im Bachelor an der TUM und der LMU studiert. Als Beispiel nennt er Troponin, dessen erhöhte Werte auf Herzerkrankungen hinweisen können. Von einer tatsächlichen Anwendung ist das Biosensor-Tattoo noch weit entfernt: „Wir sind in einem frühen experimentellen Stadium“, sagt Irmer. „Bis zur Nutzung ist es ein langer Weg.”
Die vielen Stunden im Labor und am Computer haben sich gelohnt, findet Aeneas Tews, ebenfalls Bachelorstudent der Bioinformatik. „Vieles, was wir in den Vorlesungen hören, können wir in unserem Projekt anwenden. Und wir lernen sehr viel voneinander, von Studierenden aus ganz verschiedenen Disziplinen. Das ist eine tolle Erfahrung.”
Kalina Elkin gefällt besonders das Ziel des iGEM-Wettbewerbs, Lösungen für eine gesündere und nachhaltigere Welt zu finden. „Man entwickelt etwas völlig Neues, das vielleicht eines Tages Menschen helfen kann“, sagt sie. „Dieses schöne Gefühl macht süchtig.”
- Beim iGEM Finale erreichte das Team die Top 10 in der Gesamtwertung und gewann eine Goldmedaille für Exzellenz in der synthetischen Biologie. Zudem wurden die Studierenden ausgezeichnet mit den Sonderpreisen „Best Diagnostics Project“, „Best Software“ und „Best Wiki“.
- Das Team iGEM Munich wird von den beiden Münchner Universitäten TUM und Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) unterstützt. An der TUM erfolgte die Förderung unter anderem durch die Anneliese Pfannenberg-Stiftung und den Verein Freunde der TUM.
- Ab Januar 2026 wird der Exzellenzcluster Biosystem-Design München (BioSysteM) neu gefördert. Ziel ist es, sich selbst organisierende molekulare und zelluläre Systeme mit programmierbaren, lebensähnlichen Eigenschaften zu erzeugen. Die Forschenden entwickeln biomolekulare Maschinen, intelligente Materialien oder Therapeutika. Als Grundlage neuer medizinischer Anwendungen erforschen sie auch die Steuerung der Zelldifferenzierung und Organbildung. Beteiligte Institutionen sind TUM, LMU, Max-Planck-Institut für Biochemie und Helmholtz Zentrum München.
Technische Universität München
Corporate Communications Center
- Undine Ziller
- undine.ziller@tum.de
- presse@tum.de
- Teamwebsite
Kontakte zum Artikel:
Prof. Gil Westmeyer
Technische Universität München (TUM)
Lehrstuhl für Neurobiological Engineering
gil.westmeyer@tum.de