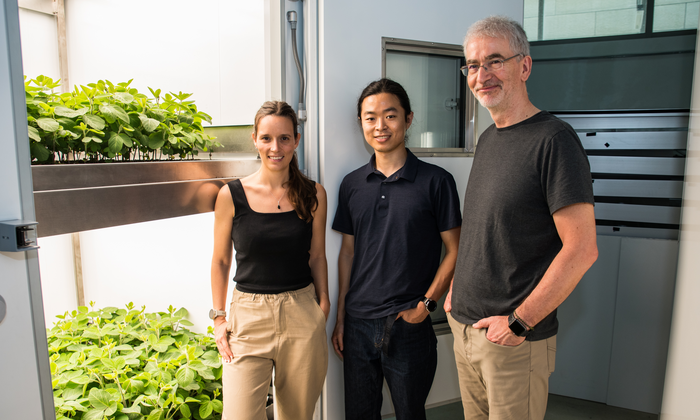NewIn: Stefan Guldin
Neue Ansätze für die Ernährung der Zukunft
Eine leichte Temperaturschwankung, ein abweichender pH-Wert oder etwas Feuchtigkeit – subtile Veränderungen und leichte Impulse reichen bereits aus, damit weiche Materie („Soft Matter“) ihre Struktur oder Funktion verändert. Ein Schlüsselprinzip dabei ist die molekulare Selbstorganisation: Winzige Bausteine auf Nano-Ebene – etwa Proteine oder Polymere – fügen sich von selbst zu geordneten Strukturen zusammen und passen sich somit flexibel an ihre Umwelt an.
Was zunächst abstrakt klingt, hat zahlreiche praktische Anwendungsfelder – von medizinischer Diagnostik über nachhaltige Wasseraufbereitung bis zur Entwicklung pflanzlicher Fleischalternativen. „An meinem Lehrstuhl entwickeln wir beispielsweise Biosensoren, die sehr gezielt an bestimmte Viren und Bakterienbestandteile andocken – und so sowohl Krankheiten als auch Verunreinigungen zuverlässig nachweisen können. Im Bereich der Umwelttechnik geht es unter anderem um Membrane, die Wasser von Salzen, Schadstoffen und Schwermetallen reinigen. Und an der Schnittstelle zur Lebensmitteltechnologie entstehen neue Ansätze für die Ernährung der Zukunft“, sagt Stefan Guldin.
Fleischalternativen für Singapur
Stefan Guldin ist aktuell an zwei Standorten der TUM aktiv: Sein Lehrstuhl ist am Campus Weihenstephan angesiedelt, zudem ist er als wissenschaftlicher Co-Direktor bei TUMCREATE in Singapur tätig. Im Projekt „Proteins4Singapore” erforscht er dort, wie sich pflanzliche Proteine so verarbeiten lassen, dass daraus nachhaltige und geschmacklich überzeugende Alternativen zu Fleisch entstehen.
Global betrachtet reicht die Bedeutung pflanzlicher Proteine weit über individuelle Entscheidungen zum Fleischverzicht hinaus. Angesichts des Klimawandels und einer weiter wachsenden Weltbevölkerung werden nährstoffreiche und gleichzeitig nachhaltig produzierte Lebensmittel immer wichtiger. „Die Landwirtschaft ist für einen erheblichen Teil der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wenn wir tierische Proteine zumindest teilweise durch pflanzliche ersetzen, könnten wir den ökologischen Fußabdruck dieses Sektors deutlich verringern“, sagt Stefan Guldin.
Obwohl der Markt für Fleischalternativen in den vergangenen Jahren gewachsen ist, sind pflanzliche Proteinalternativen noch nicht weit verbreitet. „Die derzeit verfügbaren Produkte sind oft hochverarbeitet“, erklärt Stefan Guldin. „Aber guter Geschmack braucht mehr als nur die richtige Würze.“
Geschmack und Textur
Für ein vollständiges Geschmackserlebnis müssen mehrere Faktoren zusammenwirken: das Aroma, also der Geruch eines Produkts, das Mundgefühl und die Geschmackswahrnehmung auf der Zunge. „Unser Ziel ist es, pflanzliche Fleischalternativen zu entwickeln, die möglichst natürlich sind und sich geschmacklich kaum von tierischem Fleisch unterscheiden.“ Deshalb arbeitet das Team in Singapur daran, unerwünschte Beigeschmäcker aus den pflanzlichen Proteinen zu entfernen, etwa durch Fermentation oder Enzymbehandlung. Gleichzeitig bringt Stefan Guldin seine Expertise ein, um die Konsistenz von Fleischalternativen durch kontrollierte Strukturbildung auf Mikro- und Nanoebene gezielt zu verbessern.
„Mir ist es wichtig, offene, mutige Fragestellungen ambitioniert zu verfolgen. Das zahlt sich nicht immer sofort aus, aber es wäre langfristig schade, echtes Innovationspotenzial zu verschenken, weil man sich nicht über kleine Stellschrauben hinausgewagt hat“, sagt Stefan Guldin.
Stefan Guldin ist Professor für Complex Soft Matter an der Technischen Universität München (TUM). Er studierte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und an der TUM und spezialisierte sich auf weiche kondensierte Materie. 2012 promovierte er am Cavendish Laboratory der Universität Cambridge und forschte anschließend als Postdoc an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Von 2015 an war er in verschiedenen Positionen am University College London tätig, ab 2022 als Full Professor. 2024 wurde er an die TUM berufen, wo er an der TUM School of Life Sciences den Lehrstuhl für Complex Soft Matter innehat. Derzeit ist er zudem als Wissenschaftlicher Co-Direktor im Projekt Proteins4Singapore bei TUMCREATE tätig und lebt mit seiner Familie bis Mitte 2026 in Singapur.
Dieser Artikel ist in der Ausgabe 02/2025 des neuen TUM Magazins erschienen.
- Der Lehrstuhl für Complex Soft Matter gehört zur TUM School of Life Sciences.
- Alle Folgen der Serie NewIn
- TUMCREATE ist die multidisziplinäre Forschungsplattform der Technischen Universität München (TUM) auf dem Singapore Campus for Research Excellence and Technological Enterprise (CREATE). Gemeinsam mit internationalen und lokalen Partneruniversitäten, öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen sowie Industriepartnern treiben die Forscherinnen und Forscher Zukunftstechnologien voran: Seit 2010 forscht TUMCREATE in Singapur zu Themen wie Elektromobilität, autonome Transportsysteme und bildgebende Verfahren in der Medizintechnik. Seit dem Start im April 2022 erweitert das Konsortium von Proteins4Singapore das Portfolio von TUMCREATE um ein umfassendes Projekt im Bereich Lebensmittelwissenschaft und -technologie. Die Forschung konzentriert sich auf alternative und nachhaltige Proteinquellen und die funktionsorientierte Produktion von proteinreichen Lebensmitteln. Proteins4Singapore zielt darauf ab, städtischen Zentren wie Singapur zu ermöglichen, nahrhafte, schmackhafte und funktionelle Lebensmittel als Proteinquellen zu produzieren.
Kontakte zum Artikel:
Prof. Dr. Stefan Guldin
Technische Universität München
Lehrstuhl für Complex Soft Matter
guldin@tum.de